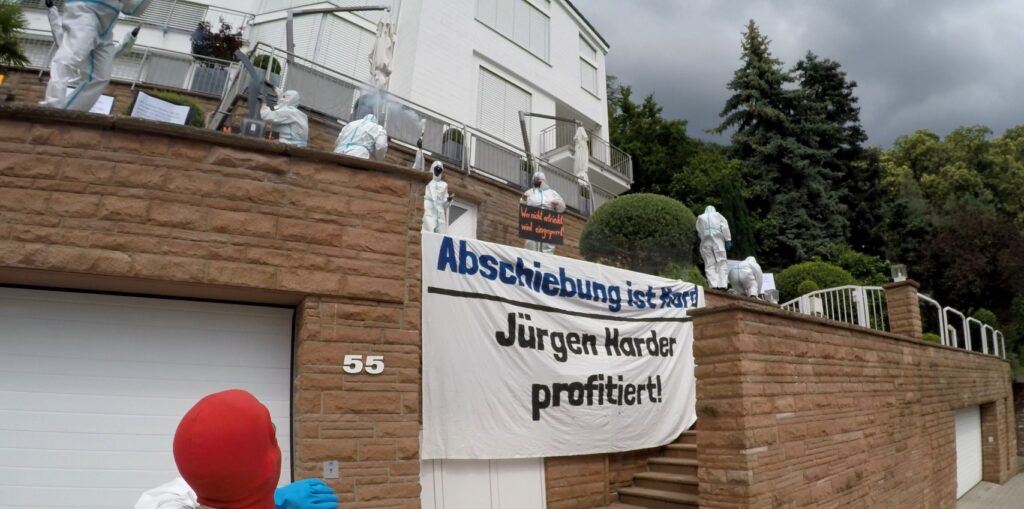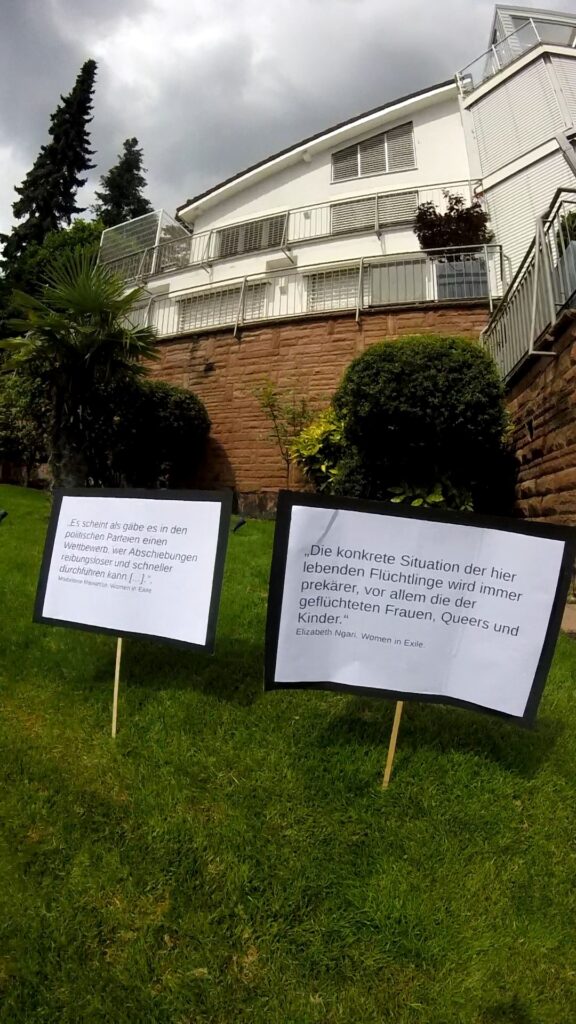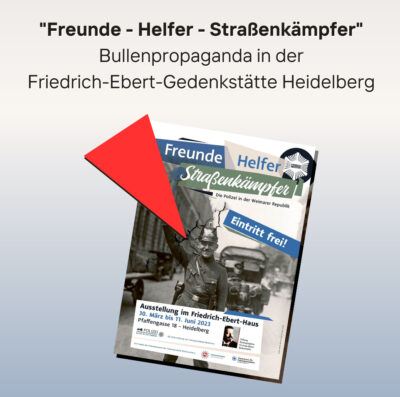Der Große Kudu | Symbolbild: Pixabay
Der Große Kudu – eine Antilopenart – gehört zu den beeindruckendsten Säugetieren Afrikas. Böcke sind bis zu zweieinhalb Meter lang, können sieben Zentner wiegen und tragen schraubenzieherförmige Hörner, die über 90 Zentimeter lang sein können. Auch im Heidelberger Zoo lebte bis zum Frühjahr ein solcher Kudu-Bock mit seiner Herde – bis entsetzte Besucherinnen Teile des bis dahin jungen und völlig gesunden Tieres im Gehege von Löwen und Tigern entdeckten.
Vorgeschichte
Der Zoo hatte sich entschlossen, die Haltung der Kudus aufzugeben, weil er mehr Platz für andere Tiere schaffen wollte. Die Weibchen konnten in Einrichtungen in Deutschland, Frankreich und der Slowakei untergebracht werden. Mitte Februar gab der Zoo bekannt, das letzte Mitglied der Großen Kudu-Herde habe den Zoo verlassen. Dass der Bock erschossen worden war, kam aber erst durch die Beobachtungen der Besucherinnen heraus. Für ihn hatte sich kein Abnehmer gefunden. Der mitgeteilte Grund: Antilopenböcke könnten nicht in bestehende Herden integriert werden, wenn diese bereits ein dominierendes Männchen haben. Außerdem habe dieser Bock seine Gene bereits durch mehrere Nachkommen weitergegeben und sei deshalb für eine weitere Zucht nicht mehr vorgesehen.
Der Tierschutzbund wies nun darauf hin, dass dieses Beispiel bei Weitem kein Einzelfall sei. In ganz Europa würden Zoos Tiere töten, die als “überzählig” gelten. Schätzungsweise 3.000 bis 5.000 Tiere jedes Jahr. Erschossen oder eingeschläfert oder mit einem Bolzenschussgerät getötet. Es handle sich dabei vor allem um Männchen und häufig um Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Im Tierschutzbund-Magazin “Du und das Tier” schreibt Redakteurin Nadine Carstens: „Sie kehren lieber unter den Teppich, wie viele ihrer Bewohner sie Jahr für Jahr töten, obwohl diese oftmals noch jung und gesund sind. Nach außen hin vermitteln viele von ihnen eine heile Welt, in der sie sich für den Artenschutz und eine Aufklärung der Öffentlichkeit einsetzen.”
‘Überzählige’ Giraffen, Gorillas und Elefanten
Der Fall des Heidelberger Kudu-Bocks ist nicht der erste, der in die Öffentlichkeit gelangte und Empörung auslöste. 2014 wurde in Kopenhagen die gesunde, eineinhalb Jahre alte Giraffe Marius getötet, vor Publikum ausgeweidet und dann den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Auch hier war es wegen Inzuchtgefahr nicht möglich gewesen, das Tier weiterzuvermitteln. Nadine Carstens hierzu: “Vordergründig gehört es zwar zu den Aufgaben von Tierparks, … bedrohte Tierarten und ihr Erbgut zu erhalten. Oft züchten Zoos aber auch Tiere, die in der Natur nicht gefährdet sind – dann ist es unter anderem das Ziel, mit dem süßen Tiernachwuchs Publikum anzulocken.”
Dass es vor allem bei der Geburt männlicher Tiere zu gefährlichen Konkurrenzkämpfen oder Platzmangel oder Inzucht kommen kann, ist nicht nur bei der Haltung von Antilopen ein Problem, sondern beispielsweise auch bei Gorillas. Im Nürnberger Tiergarten wurden deshalb jetzt zwei 2019 und 2020 geborene Gorillas kastriert, obwohl sie der vom Aussterben bedrohten Art der Westlichen Flachlandgorillas angehören. Die Tiere auszuwildern war nach Mitteilung des Tiergartens nicht möglich, weil die Lebensbedingungen in den Schutzgebieten sowieso immer schlechter würden und weil die beiden Jungtiere und freilebende Gorillas sich möglicherweise gegenseitig mit Krankheiten infiziert hätten oder durch Wilderer getötet würden.
Ungewollt bekräftigt diese Argumentation, worauf Tierschützer und Tierrechtler schon lange hinweisen: Die Haltung (nicht nur) von Menschenaffen in Tiergärten ist an sich hoch problematisch. Da keine Perspektive auf Auswilderung besteht, trägt ihre Haltung gar nicht zum Arterhalt bei, sie werden de facto nur gezüchtet, um sie zur Schau zu stellen. Auch das Problem des Platzmangels entsteht erst dadurch, dass die Tiere auf begrenztem Platz gefangen gehalten werden. Da die Affen weder ihren Bewegungsdrang noch ihr Sozial- und Fortpflanzungsverhalten ausleben können, kann die Haltung auch nicht als artgerecht bezeichnet werden.
Auch bei Elefanten können männliche Nachkommen von den Zoos häufig nicht gehalten werden. Die Herden werden von Weibchen geführt, Bullen müssen in einem bestimmten Alter die Herde verlassen. Denise Ritter, Referentin für Wildtiere beim Deutschen Tierschutzbund fasst die Problematik zusammen: “Wildtiere in Menschenobhut sind ohnehin durch die Haltung in einem künstlichen Umfeld und auf begrenztem Raum vielen Einschränkungen ausgesetzt. Das Ziel, den Tieren einen naturnahen Lebensraum zu bieten, lässt sich nicht mit einem Überschuss an Tieren vereinbaren – obwohl Zoos diese Notlage vorhersehen können, züchten sie weiter.” Für Gorillas, Antilopen, Elefanten und alle anderen Zootiere bestätigt sich die alte Erkenntnis: Artgerecht ist nur die Freiheit!
Streicheltiere werden Tierfutter
Angenommen, jemand möchte seinen Hund erschießen, weil er dessen Platz lieber für ein Terrarium verwendet oder weil der Hund sich nicht für die Zucht eignet. Dies würde mit Recht nicht nur als verwerflich, sondern auch als kriminell bezeichnet werden. Zoos jedoch töten Tiere nicht nur, weil sie Platz brauchen oder weil die Tiere gerade nicht in das Zuchtprogramm passen. Sie töten auch Tiere, die sie zuvor gezielt als sogenannte Futtertiere für Großkatzen, Krokodile, Greifvögel usw. gezüchtet haben. Es handelt sich nicht nur um Mäuse, Meerschweinchen und Kaninchen, sondern auch um größere Tiere wie Zebras, Rinder und Hirsche. 2015 enthüllte der ‘Focus’, dass der Münchner Zoo dazu auch Schafe, Ziegen und andere Tiere aus seinen Kuschelgehegen erschießt und sie dann sogenannten Beutegreifern vorwirft. Die Begründung durch den stellvertretenden Zoodirektor lautete: Die Kadaver seien noch warm und am Stück, wenn sie den Löwen, Tigern, Geparden oder Bären vorgeworfen werden. Die Raubtiere würden so auch eine Beschäftigung erhalten. Seitdem wurde bekannt, dass auch viele andere Zoos so verfahren und dass diese Praxis in ganz Europa üblich ist. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei, dass die sogenannten Streicheltiere nur solange für beste Einnahmen sorgen, solange sie klein und niedlich sind. Wenn sie größer werden, sind sie weniger attraktiv und verbrauchen mehr Platz. Dann ist es ökonomischer, sie zu verfüttern. James Brückner, Leiter der Abteilung Wildtiere beim Deutschen Tierschutzbund hierzu: “Diese Art und Weise der Bestandsregulierung stellt nicht nur einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar, sondern ist auch ethisch unverantwortlich.” Brückner ergänzt, dass er die Haltung von Säugetieren nicht für artgerecht hält: “Bei vielen Arten ist dies in Zoos schlichtweg nicht möglich, da ihr Bewegungsraum zu stark eingeschränkt ist und sie wichtige Verhaltensweisen nicht ausleben können – zum Beispiel können Großkatzen nicht jagen und Menschenaffen werden geistig nicht genügend ausgelastet.”
Wozu überhaupt Zoos?
Etwa 25 Millionen Tiere werden weltweit in mehr als 10.000 Zoos und zooähnlichen Einrichtungen gefangengehalten. 3.000 davon befinden sich in Europa, mehr als 860 in Deutschland. Etwa 2.500 Tiere aus 250 Arten werden im Durchschnitt in einem Zoo gehalten.
Vor etwa 800 Jahren entstanden in Europa Tiersammlungen, um den Reichtum und die Herrschermacht ihrer Besitzer zu dokumentieren. Die erste größere Tiersammlung entstand 1220 am sizilianischen Hof Friedrichs des II. Bis zum 17. Jahrhundert legten sich vor allem Fürsten und Kardinäle Menagerien zu, so die Medici in Florenz und Kardinal Borghese in Rom. Kaiser Ferdinand begründete 1542 bei Wien eine Tiersammlung und Ludwig XIV. 1662 in Versailles. 1789 wurde diese in eine öffentliche Menagerie im Pariser Jardin des Plantes überführt und wurde in Europa zum Modell für die Gründung weiterer Zoos, die sich vor allem an das zahlungskräftige Bürgertum richteten. Viele große Zoos entstanden im 19. Jahrhundert in jenen Ländern, die als Kolonialmächte Zugriff auf unbegrenzten Nachschub an Wildtieren hatten.
Der Tierhändler Hagenbeck öffnete seinen 1874 in Hamburg eingerichteten “Thierpark” für das Massenpublikum, indem er die Eintrittspreise senkte und die Zurschaustellung der Wildtiere mit Zirkus- und Rummelplatzattraktionen verknüpfte. Bis in die 1930er Jahre veranstalteten zahlreiche Zoos die von ihm eingeführten “Völkerschauen”, rassistische Veranstaltungen, in denen “exotische Menschen” aus “rückständigen” Ländern und Kulturen der Gafferei dargeboten wurden.
Während des ersten Weltkrieges sowie in der Nachkriegszeit erlebten Zoos und Tierparks eine Verminderung der zur Verfügung stehenden Mittel und des Interesses, erst mithilfe der imperialen Nazi-Ideologie ging es nach 1933 wieder aufwärts. Heruntergekommene Zoos wurden instandgesetzt und neue gegründet, so auch 1933 der Heidelberger Zoo, der 1934 eröffnet wurde. Ermöglicht wurde die Gründung durch großzügige Zuwendungen einer Stiftung des Geheimrates Carl Bosch. Bosch hatte 1931 den Nobelpreis für Chemie erhalten und war von 1925 bis 1935 Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns I.G.-Farben. 1933 unterstützte der Konzern unter seiner Leitung den Wahlkampf der NSDAP mit 400.000 Reichsmark, der höchsten Einzelspende der deutschen Wirtschaft an die Nazi-Partei. Bosch übernahm 1935 den Vorsitz des Aufsichtsrats, setzte sich für die Aufrüstung des NS-Regimes ein und wurde 1938 zum NS-Wehrwirtschaftsführer ernannt. Noch immer gibt es in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen Straßen, ein Museum und ein Gymnasium, die nach Carl Bosch benannt sind.
Gesellschaftliche Funktion der Zoos
Dieser knappe Galopp durch die Geschichte soll offenlegen, dass Menagerien, Zoos, Tierparks usw. in den letzten 800 Jahren eine im Grunde gleichbleibende gesellschaftliche Funktion erfüllten, eine Funktion, die zuvor die Herrscher des alten Ägypten, Persien, Griechenland und Rom auch schon, aber mit anderen Mitteln verfolgt hatten: Sie bezeugen und veranschaulichen, dass herrschende Klassen und ihre jeweiligen Systeme nicht nur über Menschen herrschen, sondern auch über die Natur, besonders über deren große und starke Tiere. Die Geschichte führt uns zu dem, was wir gerade in absurder und beängstigender Zuspitzung erleben: Dass die Herrschaft über Menschen und über die Natur zwei Seiten einer Medaille sind, weder können sie voneinander getrennt werden, noch kann die eine Herrschaft ohne die andere überwunden werden.
Aber: Tut man den Zoos von heute nicht Unrecht, wenn man unterstellt, dass dies immer noch so ist? Die problematische Geschichte der Tiersammlungen zur Zeit der Fürsten und der Könige, des Kolonialismus und der Nazizeit, wurde bisher wissenschaftlich kaum und gesellschaftlich noch weniger aufgearbeitet. Trotzdem gerieten Zoos Mitte der 1970er Jahre massiv unter Druck. Im Zusammenhang mit dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen von 1973 wurde klar, dass Wildfänge für Zoos einen enormen Anteil daran hatten, dass viele Tierarten überhaupt vom Aussterben bedroht waren. In Italien und England erreichten starke Bewegungen von ZoogegnerInnen, dass viele Zoos geschlossen wurden. Plötzlich versuchten die Zoos, Missstände zu beseitigen oder zu kaschieren und entwickelten neue Konzepte. Es setzte sich das Konzept durch, dass der “moderne Zoo” auf “vier Säulen” steht: Bildung, Artenschutz, Forschung und Erholung. In seinem “Schwarzbuch Zoo” von 2019 zeigt der Autor Colin Goldner auf, dass keine der vier Säulen einer Überprüfung standhält. Eine zentrale Kritik lautet, dass ein Verständnis der Natur in Zoos gerade nicht vermittelt wird. Wenn die Tiere in Käfigen, Bunkern und künstlichen Anlagen vorgeführt werden, fördert dies eher Zerrbilder und Klischees. Das Leiden der gefangenen, ihrer Freiheit, ihrer Kraft und ihrer Würde beraubten Tiere fällt den Menschen nicht mehr auf. Die Menschen lernen, das Widernatürliche als das Natürliche zu sehen. Wer einmal das Glück hatte, einen Hirsch im Wald zu beobachten, möge die Vitalität und Anmut dieses Tieres vergleichen mit der hoffnungslosen Lethargie, die etwa die Bisons im Käfertaler Wald ausstrahlen (die übrigens immer wieder ohnmächtig und ohne Ausweg erleben müssen, dass ein Mitglied ihrer Familie vor ihren Augen erschossen wird).
Und die Kinder?
Viele gehen vor allem der Kinder wegen in den Zoo, denn alle Kinder lieben Tiere, und viele Eltern spüren und erkennen, dass es für Kinder nicht nur schön ist, Tiere zu erleben, sondern ihnen auch in der Entwicklung emotionaler und sozialer Stärken helfen kann. Aber im Zoo oder im Zirkus erleben Kinder Tiere, die sich entweder artfremd oder apathisch verhalten. Die vernichtende Entfremdung der Gefangenschaft, die Rilke in seinem Gedicht “Der Panther” (im Jardin des Plantes) zum Ausdruck brachte, spüren unsere noch empfindungsfähigen Kinder ebenfalls, meist ohne sie jedoch in Worte kleiden oder sich überhaupt bewusst machen zu können. Zudem sehen sie, dass es anscheinend normal ist, Tiere gefangen zu halten und zur Schau zu stellen. Kinder erfassen mit ihrem feinen Gespür, dass diese Tiere leiden. Aber selbst wenn sie sich das bewusst machen und in Worte kleiden könnten, wäre es schwer für sie, dies anzusprechen, weil sie das in einen Loyalitätskonflikt zu den Erwachsenen stellen würde, die ihnen doch nur einen Gefallen tun wollen. Wer Kinder im Zoo oder im Zirkus genau beobachtet, kann sehen, wie schwer ihnen eine Orientierung fällt. Einige wenden sich ab, verlieren anscheinend das Interesse. Die meisten aber entwerten ihr eigenes Mitgefühl und nehmen es zurück. Das aber bedeutet letztendlich, dass die charakterliche und soziale Entwicklung des Kindes einen Schaden genommen hat. Es muss also die Frage gestellt werden, inwiefern Zoo- (und Zirkus)-besuche Kindern überhaupt dienen und wie diese Besuche vom Standpunkt einer emanzipatorischen Erziehung aus zu sehen sind. Diese hat ja, wie wir von Adorno wissen, das Ziel, gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse nicht einfach zu reproduzieren, sondern die Menschen dazu in die Lage zu versetzen, sie mündig, kritisch und selbstverantwortlich zu hinterfragen. Sie richtet ihren Blick auf Abhängigkeiten und Herrschaftsverhältnisse, ihr Anliegen ist die Bekämpfung aller Arten von Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Die Förderung von Empathie und Solidarität, die, wie Horkheimer es nannte “Solidarität mit der Natur überhaupt” ist ihr ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil und deshalb nicht nur Aufgabe der Eltern, sondern auch der ErzieherInnen und LehrerInnen und der gesamten Gesellschaft. Emanzipatorische Erziehung sollte hier damit beginnen, das Leid und die Ausbeutung der Tiere immer wieder sichtbar zu machen, statt es zu verschweigen, zu ignorieren oder abzuspalten.
In Deutschland allein werden an einem Arbeitstag über 15 Millionen Tiere geschlachtet, knapp vier Milliarden in einem Jahr. Etwa 99 Prozent von ihnen kommen aus Massenhaltungen, was bedeutet, dass ihr kurzes Leben viel mehr Leid beinhaltete als das Leben eines Zootiers.
Sollten Kinder auf die Spur dieses von der Fleischindustrie verhüllten und abgestrittenen gigantischen Leidens kommen und vielleicht kein Fleisch mehr essen wollen, dann, liebe Eltern, könnt ihr erkennen, dass ihr in der Erziehung eures Kindes anscheinend sehr vieles richtig gemacht habt. Vielleicht können diese Worte von Rosa Luxemburg euch und eure Kinder hierbei unterstützen:
“Eine Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden konnte, ist eine Anklage; und ein zu wichtigem Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen.”
Michael Kohler