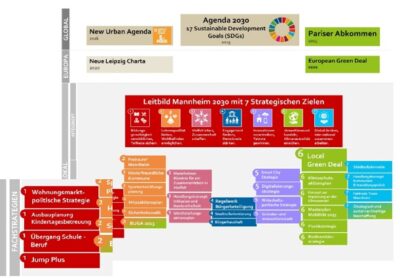Demokratiefeier 75 Jahre Grundgesetz – für viele ist ein „Gesetz“ vielleicht zu trocken?
Am Samstag, dem 25. Mai fand das große Demokratiefest im Schlosshof Mannheim statt. „Wir feiern 75 Jahre Grundgesetz – unser Garant für Demokratie und Vielfalt!“ war das Motto. Das Fest war ein Kooperationsprojekt von AWO Metropolregion und Mannheim sagt JA e.V.
Leider war das Fest nicht von Tausenden, sondern „nur“ von Hunderten besucht. Warum diese Veranstaltung nach dem riesigen Zuspruch zu der Kundgebung und Demonstration „Nie wieder ist jetzt“ vom 27. Januar nur schwach besucht war – darüber lässt sich trefflich spekulieren. Sie überschnitt sich mit dem Mannheimer Stadtfest, aber dort hätte man lange davor schon und wieder danach ausgiebig feiern können, selbst wenn man zwischendurch zum Demokratiefest gekommen wäre, um Grundgesetz-Flagge zeigen zu können. Gleichzeitig fand auch die zentral organisierte Kundgebung des Bündnisses Sahra Wagenknecht auf dem Alten Messplatz statt, zu der mehrere Hundert kamen. Vielleicht war der Zuspruch auch geringer, weil es letztlich nur die zwei Veranstalter gab und es manchen Menschen dadurch vielleicht zu speziell erschien.
Die AWO hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, von perfekter Veranstaltungstechnik bis zu zahlreichen Informationsständen, die die ganze Breite der AWO-Aktivitäten zeigten. AWO-Kreisvorsitzender Alexander Manz stellte klar: „Die AWO hat im Mannheimer Schlosshof mit einer Kundgebung für Demokratie und Vielfalt gezeigt, dass sie ein werteorientierter Verband mit Haltung ist.“ „75 Jahre Grundgesetz war und ist nicht nur ein Grund zum Feiern, es ist vielmehr auch – gerade in Zeiten, in denen der Populismus immer mehr um sich greift – Mahnung, dass wir unsere freiheitlich demokratische Grundordnung nicht als Selbstverständlichkeit erachten dürfen, sondern sie jeden Tag auf Neue erringen und verteidigen müssen. Wir machen weiter!“.
Hauptredner der Kundgebung am Nachmittag, der dann noch abends ein Kulturfest folgte, war Ex-OB Peter Kurz. Seine Rede dokumentieren wir nachfolgend in Auszügen.
Thomas Trüper
Ansprache von Dr. Peter Kurz
Liebe AWO-Freunde, liebe Freundinnen und Freunde des Grundgesetzes, der Demokratie, Europas und der Menschenrechte, liebe Anwesende,
Nie wieder…
ich bin gerne der Einladung gefolgt am heutigen Fest zu sprechen, weil „Nie wieder!“ – wie für viele meiner Generation – die wesentliche Begründung und Motivation für mein politisches Engagement war. Und dieses „Nie wieder“ begründet unser Grundgesetz und begründet die Idee eines vereinten Europas. Die hier versammelt sind, wissen: Ohne Demokratie und Rechtsstaat ist der Willkür und damit der Rechtlosigkeit von potentiell jeder und jedem und der Entmenschlichung Tür und Tor geöffnet.
Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten dies schrecklich erfahren. Sie wussten um die Gefahren. Primo Levi hat diese Gefahr in den fundamentalen Satz gefasst: „es ist geschehen, also kann es wieder geschehen.“
Was folgt daraus?
Intoleranz gegenüber Demokratiefeinden
Der Bundespräsident hat in seiner wichtigen Rede zur Feier des Grundgesetzes Carlo Schmid zitiert, der unsere Stadt 23 Jahre im Bundestag vertreten hat, und sicher als die prägendste Persönlichkeit für das Grundgesetz gesehen werden darf. Wehrhafte Demokratie bedeutete für ihn „Mut zur Intoleranz gegenüber denen zu zeigen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“ Diese Aufforderung wird erst jetzt, nach Jahrzehnten, aktuell.
Wir hatten unverhofftes Glück: Wir mussten die Wehrhaftigkeit der Demokratie Jahrzehnte lang nicht ernsthaft bemühen.
Doch das darf uns den Blick nicht darauf verstellen, dass Wehrhaftigkeit notwendig ist.
Gefahren für die Demokratie – AfD
Heute sind wir nicht nur damit konfrontiert, dass zu viele Menschen die Gefahren unterschätzen. Wir sind mit der schockierenden Tatsache konfrontiert wie ungehemmt Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als Partybelustigung zur Schau gestellt wird. Wir sind damit konfrontiert, dass heute der Nationalsozialismus, der verantwortlich ist für das größte Menschheitsverbrechen, von Abgeordneten – Mandatsträgern in unserer Demokratie – verharmlost oder sogar positiv in Bezug genommen wird. Das ist unerträglich.
Wer das versteht und sich zu Demokratie und Menschenwürde bekennt, kann sich nicht engagieren in einer Partei, deren Mandatsträger, deren bestimmende Personen genau dies tun. Nicht einmal die radikalen Rechten im europäischen Parlament lassen das der AfD mehr durchgehen. Deshalb: Wer sich für welche Themen auch immer in dieser Gesellschaft politisch einsetzen will, muss dies nicht für eine Partei tun, in der Leute die Demokratie umbringen wollen, um mit Carlo Schmid zu sprechen. Und wer es tut, macht sich damit gemein, Die Ausrede „Das darf man nicht so ernst nehmen“ ist die aktuelle Variante von „ das haben wir nicht gewusst“. Das darf man nicht hinnehmen.
(…)
Demokratie – Rechtsstaat – Gleiche Rechte – Gleichwertigkeit
Zur Demokratie gehört der Rechtsstaat, der dafür sorgt, dass nicht nur Minderheiten, sondern jede und jeder Einzelne Schutz genießt, und dass der Staat sich rechtfertigen muss.
Vor allem aber gehört zur Demokratie, dass alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte und den gleichen Geltungsanspruch haben. Und das ist etwas, das uns alle bindet, nicht nur den Staat.
Dem parlamentarischen Rat sah „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ nicht nur als eine Anforderung an den Staat. E r verstand es als eine Anforderung an alle, die Teil der Gesellschaft sind. Das ist exakt das, was Margot Friedländer in den einfachen Satz kleidet „Seid Menschen!“
Das ist exakt das, was Margot Friedländer in den einfachen Satz kleidet „Seid Menschen!“
Es ist zuallererst die Anforderung, jeden anderen Menschen als gleichwertig anzuerkennen.
Dies ist der archimedische Punkt der Demokratie. Das ist ihre Rechtfertigung: Wir sind nicht Demokraten, weil das den meisten Wohlstand garantiert. Wir sind Demokraten, weil Menschen gleichwertig sind.
Angriffe auf die Gleichheitsidee
Der Angriff auf die Demokratie verbindet sich nicht zufällig mit dem immer offener formulierten Angriff auf die Gleichheitsidee. Der Ausschluss von Menschen ist das Wesensmerkmal der Bewegungen, die aktuell Demokratie untergraben.
Wer die Gleichwertigkeit von Menschen verneint, zerstört den für ein soziales und gewaltfreies Zusammenleben erforderlichen Grundkonsens. Wer so argumentiert und handelt, wird nicht ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Demokraten, er schließt sich selber aus.
„Seid Menschen“ schafft ein Bewusstsein dafür, dass eine pflichtschuldige Distanzierung von Bedrohung und Gewalt nicht reicht! Wer Plakate hängt, dass Wohnungen frei werden, wenn man Menschen abschiebt, appelliert an die niedersten Instinkte. Wer sprachlich andere entmenschlicht, säht Gewalt. Die mörderische Bedrohung von Menschen, weil sie eine Synagoge besuchen, die gestern in unserer Region manifest wurde, hat etwas zu tun mit dem Klima, das in unserem Land erzeugt wird. Genauso wie die zunehmende Gewalt gegen politisch Engagierte..
Soll eine Gesellschaft menschlich sein, muss die Rhetorik der Ausgrenzung und Abwertung eingedämmt werden und Gewaltfreiheit konsequent und mit größtmöglicher Entschiedenheit eingefordert werden. Das unterscheidet Demokraten von den Feinden der Demokratie und muss sie unterscheiden.
Israelis und Palästinenser
Und das sind unsere Maßstäbe an alle: Wenn auf einer Pro-Palästina-Demonstration in Mannheim gesagt wird, man werde keine Gewalt ausüben, aber man wolle einzelne, mit Namen Genannte den Hass spüren lassen, wenn Menschen, die an israelische Opfer erinnern, als Mörder beschimpft werden, dann kann dafür niemand Akzeptanz erwarten.
Umgekehrt darf nicht jeder Protest gegen die israelische Reaktion und jede differenzierte Position denunziert werden. Auch das passiert jedoch in zu hohem Maß.
Auch hier gibt der Satz „Seid Menschen!“ Orientierung.
Danach wäre es selbstverständlich, auf beiden Seiten Leiden und Opfer betrauern und wechselseitig anerkennen zu können.
Orientieren wir uns daran, muss es möglich sein, nicht nur der Trauer sondern auch politischen, kontroversen Diskussionen zu Israel und Palästina Raum zu geben. Daran fehlt es. Und auch das ist schädlich.
Denn auch innerhalb derer, die Demokraten sind, ist eine Maßlosigkeit in der Sprache und Ausgrenzung Alltag geworden, die unsere Fähigkeit, wirklich zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden, untergräbt. Und damit auch die Demokratie selbst. Vor allem verwischt diese Art der Auseinandersetzung die Grenze zwischen Demokraten und denen, die Demokratie bekämpfen.
„Seid Menschen“ kann auch hier eine gute Richtschnur sein.
Geht es noch um die Auseinandersetzung mit Meinungen oder geht es um Ausgrenzung von anderen aus einer Gemeinschaft?
Letzteres dürfen wir als Demokraten nicht tun und es ist schon längst verbreitete Praxis geworden. Das muss enden!
(…)
Europa
(…) Dennoch wird Europa und seine Idee bedroht – von außen und von innen. Werden seine wesentlichen Werte missachtet.
Mehr Nationalismus soll wieder eine Lösung für alle Themen sein, die Unbehagen auslösen, obwohl der Nationalismus nicht nur keine Lösungen anzubieten, sondern immer nur Leid gebracht hat.
Seien wir als Pro-Europäer selbstbewusster.
Mir hängen zu viele Plakate mit den Slogans , die ein starkes eigenes Land in Europa beschwören. Das ist die falsche Botschaft. Wir wollen ein stärkeres, wir wollen ein demokratischeres Europa. Ein Europa, das Demokratie in den Ländern besser sichert!